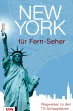In Memoriam Tana Schanzara
Zwischen Sigi Harreis, Horst Tappert und Peter Steiner ist der Tod des Ruhrgebiets-Originals Tana Schanzara ein wenig untergegangen. Das ist ungewöhnlich. Tana Schanzara spielte zwar meistens nur Nebenrollen, fiel damit aber immer auf. Vor allem war sie in Filmen zu sehen, aber auch in den Fernsehserien Hagedorns Tochter, Dreifacher Rittberger, 6 Richtige und Medienklinik wirkte sie mit. „Omma“ oder „Putzfrau“ in jeweils mehreren Inkarnationen waren ihre Paraderollen.
Der folgende Ausschnitt stammt aus Hape Kerkelings Film „Club Las Piranhas“.
Tana Schanzara starb am vergangenen Freitag, als sie 83 Jahre alt wurde.
In Memoriam Tim Russert

Screenshot: NBC
Amerika trauert um den Politjournalisten Tim Russert. Russert moderierte bis zuletzt den US-Polittalk Meet The Press und war eine amerikanische Institution innerhalb einer Institution. Die Sendung selbst gibt es seit 61 Jahren und ist die weltweit älteste Fernsehsendung. Russert moderierte sie seit 17 Jahren, viel länger als alle seiner Vorgänger. Er starb plötzlich, war erst 58 Jahre alt. Am Freitagnachmittag brach er im Studio zusammen, während er die Sendung für morgen vorbereitete.
Meet The Press wird gern als Vorbild für den deutschen Presseclub genannt, was nicht dadurch richtig wird, dass die Titel so ähnlich klingen und beide Sendungen sonntags am Vormittag oder Mittag laufen. Man kann Tim Russerts Stellenwert schlecht verdeutlichen, wenn man sich als deutsches Gegenstück zum Beispiel Peter Voß vorstellt. Aus so unglaublich vielen Gründen. Während sich im deutschen Presseclub die Presse trifft und unter sich bleibt, treffen in Meet The Press hochrangige Politiker auf die Presse und stellen sich den Fragen. Inhaltlich ist die Show also näher am Sonntagabend-Talk der ARD als am Presseclub, nur eben mit hochrangigen Politikern. Und Fragen. Und einem informierten und motivierten Moderator, den Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Menschen weltweit zählte. (Andererseits nennen die Amerikaner auch ihre nationale Baseballmeisterschaft Weltmeisterschaft, aber das ist jetzt nicht das Thema.)
Niemand, der in Washington wichtig ist, wurde von Russert nicht vernommen. Das ist eine oft benutzte Floskel, die in diesem Fall mal stimmt.
Präsident George W. Bush, Ex-Präsident Bill Clinton, die Präsidentschaftskandidaten Barack Obama und John McCain und viele andere wichtige Persönlichkeiten drückten öffentlich ihre Trauer aus. Alle priesen Tim Russert als einen der herausragenden Journalisten unserer Zeit und für seine Fairness in seiner Berichterstattung und seinen hartnäckigen Interviews. Richtig: Russert war hart, aber fair.
Er hatte neben seiner Sonntagssendung immer wieder Kandidatendebatten im Präsidentschaftswahlkampf oder Vorwahlkampf moderiert, trat an Wahlabenden mit seiner Einschätzung auf, mit der er oft scharfsinniger und schneller war als andere, und war auch im aktuellen Wahlkampf einer der prominentesten Berichterstatter. Ferner war er der Washingtoner Büroleiter des Senders NBC, der gestern Nachmittag sein Programm unterbrach, um von Russerts Tod zu berichten.
Die NBC-Hauptnachrichten am Abend behandelten kein einziges anderes Thema, was vielleicht vermessen und nach Selbstbeweihräucherung klingt und wohl auch geringfügig übertrieben ist, aber tatsächlich die Nachrichtenlage recht gut reflektierte. In den USA gab es gestern kein wichtigeres Thema. Auch bei den Konkurrenten ABC und CBS war Tim Russerts Tod der Aufmacher, selbst CBS widmete dem Thema mehr als die Hälfte der Sendezeit seiner Hauptnachrichten.
Russerts plötzlicher Tod führte zu einigen Merkwürdigkeiten in der Berichterstattung. Brian Williams moderierte die nach ihm benannten NBC Nightly News with Brian Williams live von der Bagram Air Base in Afghanistan, was ungefähr darauf hindeutet, welche Inhalte ursprünglich geplant waren. Stattdessen wurden sämtliche Beiträge und Interviewpartner aus New York und Washington zugeschaltet. Moderatorin Katie Couric, Namensgeberin der CBS Evening News with Katie Couric, hatte gestern zwar frei, weshalb Harry Smith sie vertrat, wurde aber in ihrer eigenen Sendung interviewt, um ihre Erinnerungen an Tim Russert zu teilen.
2004 machte Russert auch seinen Vater landesweit berühmt, einen ehemaligen Müllmann mit dem Spitznamen „Big Russ“. Tim Russert veröffentlichte seine Kindheitserinnerungen in einem Buch, das er „Big Russ And Me“ nannte und ein Nr.1-Bestseller wurde.
In diesem Zusammenhang abschließend ein Ausschnitt aus Meet The Press, über den Amerika vor einem Monat herzlich lachte. Russerts Gast war Hillary Clintons Wahlkampfmanager Terry McAuliffe, der zu überzeugen versuchte, dass Hillary Clinton Präsidentin werden könne.
Es ist nicht unmöglich, dass Hillary Clinton noch gewinnt! Auch wenn viele Leute das sagen. Wenn Big Russ jetzt hier säße, er würde sagen: „Nichts ist unmöglich!“ Jack McAuliffe auch, wenn er heute bei uns wäre. Die beiden sitzen jetzt wahrscheinlich im Himmel, trinken einen Scotch, schauen auf uns herab und sagen: „Genau! Der Kampf geht weiter!“
Leider hatte die flammende Rede zwei Schönheitsfehler: Hillary Clinton hatte auch zu diesem Zeitpunkt rechnerisch bereits keine Chance mehr, Präsidentschaftskandidatin der Demokraten zu werden. Und Big Russ lebt noch.
In Memoriam: The Blobs
BBC Three hat seinen sensationell sympathischen Pausenfüllern, den Blobs, gekündigt. Die Blobs sind rotbraune, gummiartige, angenehm adipöse Wesen, die zwischen den Sendungen auftauchten. Sie haben weder Nasen noch Arme und Beine, weil sie ursprünglich von Aardman Animations („Wallace & Gromit“) entwickelt wurden, um allein mit Augen- und Mundbewegungen möglichst genau und aussagekräftig gesprochene Texte nachzubilden. Die Agentur Lambie-Nairn machte aus ihnen die Idents für BBC Three, für die vorhandene Tonschnipsel verwendet wurden.
Ja, sehr merkwürdig. Und so toll:
Nach fünf Jahren hat die Marktforschung nun angeblich ergeben, dass Menschen, die keine Stammzuschauer des jungen und vergleichsweise radikalen BBC-Three-Programms waren, die Blobs verwirrend, kalt und krakeelerisch fanden. Deshalb verschwinden sie jetzt skandalöserweise im Rahmen eines größeren Relaunches des Senders, dürfen sich aber vorher wenigstens noch mit Stil verabschieden — unter anderem mit „So long, Farewell“, „Bye Bye Baby“ und „I will survive“.
(Und das „Organgrinder“-Blog des „Guardian“ hat schon die notwendige Kampagne gestartet: „Save the BBC3 blobs“.)
In Rente geschicklt
Deutschlands Fernsehkommissar mit der größten Ausdauer hat sich verabschiedet. Wilfried Klaus war als Horst Schickl von der SOKO 5113 nicht nur der dienstälteste deutsche Krimiermittler, sondern übertraf auch die Amtszeiten von Derrick und allen Alten um Längen. Nach Amerika müssen wir gar nicht erst schauen. James Arness als Marshal Matt Dillon in Rauchende Colts und Kelsey Grammer als Psychiater Frasier Crane in Cheers und Frasier spielten ihre Rollen jeweils 20 Jahre und gelten in den USA als Rekordhalter. Klaus spielte den Schickl mal eben zehn Jahre länger.
Seinen letzten Fall zog das ZDF als großes Finale auf: In Spielfilmlänge und zur Primetime, und wie in einer großen Samstagabendshow kamen zum Schluss noch einmal alle Mitwirkenden auf die Bühne. Schickls letzter Fall beinhaltete Wiedersehen mit vielen Stars aus den großen SOKO-Jahren in den 80ern und 90ern: Bernd Herzsprung als Fred Leß, Olivia Pascal als Lizzy Berger, Heinz Baumann als Jürgen Sudmann, und dazu Christine Döring als Susanne von Hagenberg, die ab 2000 sechs Jahre zum festen Team gehörte. Selbst der verstorbene Werner Kreindl als Ex-SOKO-Chef Karl Göttmann spielte noch einmal eine Rolle, zwangsläufig passiv. Schickls letzter Fall trug den Episodentitel „Die Akte Göttmann“ und schrieb nebenbei fast 20 Jahre SOKO-Geschichte neu. (Es folgen Handlungsdetails. Wer sie nicht wissen möchte, bitte beim nächsten Absatz weiterlesen oder joggen gehen.) Lizzy wird umgebracht! Göttmann starb vor 15 Jahren nicht an einem Herzinfarkt, sondern wurde ebenfalls umgebracht! Und zwar von einem Maulwurf bei der Polizei! Und dieser Maulwurf war Fred Leß! Und am Ende lässt sich Schickl zum Schein erschießen, um unter falschem Namen ein neues Leben zu beginnen, weil die Menschenhändler aus seinem letzten Fall ihm Rache geschworen haben! Puh.
Die Handlung war stellenweise an den Haaren herbeigezogen, doch so ließen sich eben die Gastauftritte der Altstars am besten integrieren. Ohne sie hätte die man die Geschichte freilich in der halben Zeit erzählen können, aber das wäre nicht angemessen gewesen. Und dass in dem Moment, in dem klar ist: „Wir haben einen Maulwurf!“, erst mal der Kreis der Eingeweihten verdoppelt wird — geschenkt. Es war ein würdiges Finale zum Abschied von Wilfried Klaus, das ein bisschen wie ein Serienfinale wirkte, obwohl die Serie auch ohne ihn weitergeht. Doch er war der letzte Mann der ersten Stunde. Ohne ihn wird sich die Original-SOKO-Serie wohl kaum noch von den gefühlt 5113 anderen SOKO-Serien mit ihren jährlich wechselnden Besetzungen unterscheiden. Hartmut Schreier und Michel Guillaume sind jetzt die Dienstältesten, beide immerhin auch schon seit mehr als 15 Jahren dabei.
Wilfried Klaus, der im Gegensatz zu anderen ZDF-Stars in jüngerer Vergangenheit freiwillig aufgehört hat, geht bis auf weiteres mit der langlebigsten Serienrolle im deutschen Fernsehen in die TV-Geschichte ein.
In vier Jahren kann Claus Theo Gärtner als Josef Matula in Ein Fall für zwei an ihm vorbeiziehen.
In Zukunft wird gelacht – aber bloß noch nicht jetzt!
US-Sitcoms erleben im deutschen Fernsehen wieder einen Boom. Kabel 1 zeigt tagsüber nichts anderes mehr, und ProSieben hat es endlich geschafft, eine Sitcom erfolgreich in der Primetime zu platzieren, und das auch noch gegen Dr. House.
Wie passt es dazu, dass einfach niemand die Sitcom Rules Of Engagement sehen will, die Kabel 1 an den beiden vergangenen Donnerstagen um 20.15 Uhr gezeigt hat (und angesichts der miserablen Quoten dort vielleicht nicht mehr lange zeigen wird)?
Ganz einfach. Es gibt etwas, das Rules Of Engagement von den erfolgreichen Sitcoms unterscheidet: Die Serie ist neu. Neue Sitcoms funktionieren nicht. Die müssen erst mal alt werden.
Beispiele? Gern. Two And A Half Men, der neue Vorzeige-Erfolg des Dienstagabendprogramms von ProSieben, ist bereits in der sechsten Staffel. Die ersten viereinhalb Staffeln liefen nur mittelmäßig erfolgreich im Nachmittagsprogramm am Wochenende, die erste sogar noch unter dem Titel Mein cooler Onkel Charlie. Da musste erst Kabel 1 kommen und die ersten 96 Folgen immer und immer wieder im täglichen Nachmittagprogramm runterspulen. Seit Januar geschieht das, und in dieser Zeit haben sich die Zuschauer an die Serie gewöhnt und sie lieb gewonnen, und immer mehr sind dazu gekommen und lachen mit den Stammzuschauern über die Witze, die sie schon kennen. Die Erstausstrahlung von zwei Episoden der Serie Rules Of Engagement hatte gestern Abend zur besten Sendezeit weniger Zuschauer als zwei Elftausstrahlungen von Two And A Half Men mittags um 12.
So erging es auch King Of Queens. RTL2 sendete die anfangs nur mittelmäßig erfolgreiche Serie so lange in Dauerschleife, bis sie ein Erfolg wurde und später bei Kabel 1 ebenfalls in der Primetime landete. Zum Serienfinale war King Of Queens plötzlich sogar Marktführer auf ihrem Sendeplatz am Montagabend. Auch die beiden heutigen RTL2-Dauerbrenner Immer wieder Jim und Still Standing, die heute passable Zahlen erreichen, taten dies frühestens bei der dritten Wiederholung und waren vor drei Jahren als Flops gestartet. Friends begann 1996 im Nachmittagsprogramm und schaffte erst mit der achten Staffel den Sprung in die Primetime. Das Muster lässt sich bis zum Klassiker Eine schrecklich nette Familie zurückverfolgen, bei dem der Kult vor 17 Jahren erst mit der deutschen Drittausstrahlung begann.
Auf der anderen Seite stehen die neuen Sitcoms, bei denen die Sender den Mut hatten, sie gleich im Hauptabendprogramm einzusetzen, und dann enttäuscht wurden, zum Beispiel Rules Of Engagement oder Samantha Who. Und selbst zu Randsendezeiten nachts oder nachmittags werden neue Sitcoms den Ansprüchen der Sender zum Start in den seltensten Fällen gerecht. My Name Is Earl und How I Met Your Mother sind hier tragische Beispiele. Diese beiden Serien haben aber das Potenzial, Erfolge zu werden, wenn eines Tages ein Sender auf die Idee kommt, auch sie als tägliche Dauerschleife zu programmieren und den Gewöhnungseffekt bei den Zuschauern abzuwarten. Genügend Episoden sind in beiden Fällen vorhanden. Earl wurde in den USA nach 96 Folgen eingestellt, exakt so viele sind auch von Mother bisher gelaufen, da geht’s aber sogar noch weiter. Die skurrilen Figuren, die so gern zum Kult werden, sind in beiden Fällen vorhanden, nur der Ausstrahlungsmodus noch nicht.
Rules Of Engagement ist noch jung und kann sich noch entwickeln, aber vermutlich nicht mit einer wöchentlichen Ausstrahlung. Die Abstände zwischen den Folgen sind offenbar zu groß, um diesen nötigen Gewöhnungseffekt für Comedys zu erzielen oder die Serien überhaupt zu entdecken. Was der Zuschauer nicht kennt, frisst er nicht. Woran er nicht mehr vorbeikommt, weil jeden Tag vier Folgen laufen, das mag er plötzlich. Insofern sind neue Sitcoms für die Sender nur das: Eine Geduldsprobe und eine Investition in die Zukunft.
Inas Nacht
2007–2009 (NDR); seit 2009 (ARD). Lustige Sauf-Show in der Tradition der fröhlichen Weinrunde. Ina Müller meist zwei prominente Gäste sitzen am Tresen einer Hamburger Kneipe, trinken Bier, unterhalten sich und werden dabei immer wieder von den Seemannsliedern eines Shantychors oder einer grölenden Ina Müller unterbrochen. Zuschauer dürfen auf Bierdeckeln Fragen an die Gäste einreichen. Außerdem treten musikalische Gäste auf und singen weitere Lieder. Unmusikalische auch.
Nach knapp drei Jahren an Samstagabenden im NDR wechselte die Show ins Erste, lief dort zunächst am späten Donnerstagabend, seit 2011 wieder samstags. Die Show dauert eine Stunde, läuft in Staffelblöcken wöchentlich.
Interview: Hannes Jaenicke
Hannes Jaenicke und ich schauen die gleichen Serien. Nämlich alle. Naja, fast. Wir teilen die Vorliebe für die Münsteraner Tatort-Kommissare und eine Abneigung gegen David Carusos Gehabe in CSI: Miami, mögen aber die CSI-Varianten aus Las Vegas und New York. Als ich die vielen Gemeinsamkeiten bemerkte, fragte ich irgendwann nur noch sein Sehverhalten für Einzelsendungen ab.
Im Grunde ging es um die Unterschiede zwischen deutschem und amerikanischem Fernsehen, und warum US-Serien derzeit so erfolgreich sind. Jaenicke kennt beide Seiten. Er ist einer der wenigen deutschen Schauspieler, die in Hollywood mehr als einen Fuß in der Tür haben und wirkte neben vielen deutschen auch in zahlreichen amerikanischen Produktionen mit. Weil er die Hälfte des Jahres in Los Angeles lebt, ist er auch als Zuschauer beiden Modellen gleichermaßen ausgesetzt.
Hannes Jaenicke ist der Star der neuen RTL-Serie Post Mortem (ab 18. Januar donnerstags um 20.15 Uhr), die sehr amerikanisch daherkommt.
Mögen Sie das amerikanische Fernsehen?
Ich habe sehr viel amerikanisches Fernsehen gemacht und denke, das sehen wir ja an den Quoten, dass die völlig einsam in der Qualität ihrer Fernsehproduktionen sind. Das ist im Moment nicht zu schaffen, was die machen. Schon seit Jahren. Das fängt bei den Sopranos an, sogar schon bei den Straßen von San Francisco und Columbo. Die Amerikaner machen seit fünfzig Jahren das führende Fernsehen. Das ist die Latte, an der wir uns messen müssen.
Vor allem die Krimis sind im Moment sehr erfolgreich.
Aber es laufen ja auch die Comedys. Schauen Sie sich Desperate Housewives an, Sex And The City, Will & Grace. Die haben eine Fernsehkultur, die wir vielleicht irgendwann, und das wird lange nach meinem Ableben stattfinden, vielleicht mal hinbekommen. Ich werde das nicht mehr erleben.
Aber Sie versuchen es ja gerade mit Post Mortem und lehnen sich dabei stark an CSI an.
Natürlich können wir das Format Rechtsmedizin nicht neu erfinden. Was Thomas Jauch, der Regisseur, und ich uns in den Kopf gesetzt haben, war: Wenn wir das machen, muss es anders aussehen als andere deutsche Fernsehprodukte. Und wir sind natürlich große 24-Fans, und Sie werden schnell feststellen, dass wir das sehr ähnlich aufgelöst haben vom Schnitttempo her. Wir wollten es stilistisch anders machen, als es hierzulande bislang gemacht wird. Wenn das geglückt ist, dann sind wir schon mal froh.
Man sieht zumindest deutlich, dass diejenigen, die dahinter stecken, sich mit dem amerikanischen Fernsehen befasst haben. Viele Produzenten versuchen sich an einem Abklatsch, ohne sich ernsthaft mit den Originalen auseinanderzusetzen.
Thomas Jauch und ich sind bekennende Fans von Michael Mann und Scorsese und anderen amerikanischen Serien. Wir gucken Die Sopranos, und wir haben uns natürlich sämtliche Folgen von 24 reingezogen. Thomas und ich sind sicher vom amerikanischen Fernsehen stärker beeinflusst als viele andere hierzulande. Das mag man uns jetzt vorwerfen, und das passiert auch regelmäßig, aber das ist nun einmal unser Geschmack. Und Thomas Jauch versteht nicht nur was vom amerikanischen Fernsehen, er hat auch die handwerklichen Fähigkeiten, das tatsächlich selber zu drehen. Ich glaube, wir sind die erste deutsche Fernsehproduktion in der Geschichte, an der zwei US-Studiobosse ans Set gekommen sind, um zu sehen, wie wir das machen.
Wie kam das?
Bei den May-Screenings (der jährlichen Veranstaltung in Los Angeles, bei der die neuen Serien der kommenden TV-Saison erstmals vorgeführt werden), wurde der Pilot gezeigt, und drei, vier Monate später hatten wir plötzlich Michael Lynton am Set und eine Woche später Michael Grindon, die Bosse von Sony/Columbia Tristar. Die wollten einfach mal zusehen. Und die waren, ehrlich gesagt, ziemlich geplättet. Die kennen natürlich deutsches Fernsehen und sind anderes gewohnt, hierzulande, die kennen die sonst übliche deutsche Erzählform, den deutschen visuellen Stil. Und die haben plötzlich gesehen, dass es da ein paar Deutsche gibt, die das so machen wie die Amis.
Das Lustige ist: Der Vorwurf, dass wir CSI nachmachen, kam nie aus Amerika. Die haben sich das angesehen und fanden das großartig. Da hat kein Mensch gesagt: „It’s like CSI„. Oder „It’s like Cold Case„. Sondern nur: „Das ist aber geil. So was haben wir in Deutschland noch nie gesehen.“ Und das ist für uns ganz interessant.
Empfinden Sie es als Vorwurf, wenn ich sage: Das sieht aus wie CSI?
Bei Ihnen nicht. Aber der „Stern“ hat uns gerade fürchterlich in die Pfanne gehauen, die sagen: Ja, aber Vegas ist viel geiler als Köln. Und das ist so typisch deutsch. Wir werden das Format nicht neu erfinden. Auch Ulrich Mühe macht seit Jahren Rechtsmedizin, und auch Jan Josef Liefers macht Rechtsmedizin. Letztendlich machen wir ja alle CSI und Cold Case nach. Aber wir haben eben versucht, es mal stilistisch anders zu machen. Vielleicht ein bisschen flotter, ein bisschen radikaler. Und wenn der „Stern“ dann schreibt, der Caruso mit seiner Sonnenbrille ist cooler als der Jaenicke, dann beleidigt mich das.
Der kann sich ganz toll 45 Minuten lang diese Sonnenbrille immer wieder auf- und absetzen, bis der Fall gelöst ist.
Aber der „Stern“ findet das halt tausendmal cooler als mich. Und dann steht da drin, Miami ist einfach sexier als Köln. Na gut, großes Kunststück. Die haben Palmen und Sandstrände. Daraus einen Strick zu drehen, dass man das hier gleich lassen sollte, ist unglaublich dämlich. Außerdem erzählen wir deutsche Geschichten. Die Geschichten haben mit russischen Einwanderern zu tun, mit dem Verbot von Sterbehilfe, wir erzählen bundesrepublikanische Realität.
Stimmt es, dass Sie immer schon einen Krimi-Kommissar spielen wollten?
Ganz ehrlich: Ich würde gerne einen deutschen Tatort-Kommissar spielen. Den würde ich dann aber auch gern ein bisschen anders gestalten. Wir haben seit Schimanski keinen Kommissar mehr gehabt, der sich mal daneben benimmt. Ich finde, auch der Tatort ist mittlerweile sehr gediegen geworden. Ich hätte gern einen, der mal nicht so konformistisch vorgeht.
Was halten Sie denn von den Münsteranern?
Die finde ich klasse. Die haben gute Autoren, und endlich mal Humor! Das ist unbezahlbar. Und was Prahl und Liefers da spielen ist einfach großartig. Das ist ein Tatort, den sollte man bitte genau so weiterlaufen lassen. Es gibt auch in Köln oder München großartige Tatorte. Trotzdem fände ich ein bisschen frischen Wind in dieser doch mittlerweile inflationären Tatort-Szene nicht so schlecht. Sich da etwas einfallen zu lassen wäre eine spannende Aufgabe.
Wenn Sie sich in Post Mortem in der Gerichtsmedizin über Leichen beugen oder im Labor Tröpfchen in Fläschchen fallen lassen, wissen Sie dann immer, was Sie da gerade tun?
Da wir die komplette Kölner Rechtsmedizin als Beraterstab haben, sind wir da ziemlich gut gebrieft worden. Wir hatten Prof. Markus Rothschild als Chefberater, das ist Deutschlands führender Rechtsmediziner, und der hat einen ganzen Stab von wirklich sensationell hilfsbereiten, klugen, tollen Leuten. Die sind auch erstaunlich witzig, das war eine richtig tolle Truppe. Wenn wir am Sektionstisch standen, stand immer ein Profi dabei. Und wenn wir Begriffe im Text hatten, die wir nicht verstanden haben, wurden sie uns erklärt. Wir haben uns da richtig schlau gemacht. Wenn man dann über diesen Puppen herumhantiert, mit Schweineleber und Schweineherz… Das hat ja bei diesen Leuten eine unglaubliche, sehr kühle, professionelle Selbstverständlichkeit. Professor Rothschild hat oft junge, angehende Fachärzte, die dann mit ganz großer Betroffenheit über einer Selbstmordleiche knien, und dann sagt er: Wer so guckt, fliegt raus. Der will da kein Mitleid, der will auch kein Gefühl. Der will, dass da sachlich gearbeitet wird. Und das kriegt man nur, wenn man mal dabei war, wie die den Darm da rausziehen. Und das Herz. Und das Hirn. Standardgemäß wird ja alles rausgenommen, was der Körper so hergibt. Und ich hab‘ mir das so lange angesehen, bis das für mich auch eine gewisse Selbstverständlichkeit hatte.
Gab es bei den amerikanischen Vorbildern ein spezielles, an dem Sie sich besonders orientieren wollten?
Thomas Jauch und ich haben uns 24 so lange angesehen, bis es uns zu den Ohren rausgekommen ist. Das ist natürlich nicht inhaltlich das Vorbild, aber stilistisch. Wir wollten auch wissen, wie sie das machen, dass die dauernd so schamlos über die Achse gehen. Der Achsensprung wird ja bis heute in Deutschland heiliggesprochen. Rechts, links, links, rechts, und 24 war die erste Serie, die gesagt hat, wisst ihr was, Achsensprung gibt’s für uns nicht mehr. Die springen aus jedem Winkel in jedes Gesicht, in sieben verschiedenen Größen, und das hat eine Energie im Bild, die man nicht hinkriegt, wenn man konventionell dreht. Das haben wir uns zugegebenermaßen reingepfiffen, bis wir nicht mehr konnten.
Bei den CSIs ist mir William Petersen der Nächste, also die Vegas-Variante. Gil Grissom ist die Figur, bei der sich die Autoren am meisten trauen. Der überrascht mich am meisten, der konnte ja in der letzten Staffel plötzlich die Taubstummensprache, und zwar perfekt. Die haben so viel Mut beim Erzählen, das ist so unorthodox gemacht. Von den Autoren und Figuren her finde ich diese die spannendste Variante. Und Caruso und Miami ist mir einfach zu … bunt. Also, das ist nicht mein Favorit.
Aber CSI: NY müsste Ihnen wieder gefallen.
Ja, da ich ein alter Theaterhase bin und weiß, dass Gary Sinise mit der Steppenwolf Theatre Company eine der besten Theatertruppen der USA betreibt und Herrn Sinise mehrfach auf der Bühne gesehen habe. Ich bin ein ganz großer Fan von ihm. Und ich finde die Serie auch von der Düsternis unheimlich schön gemacht. CSI: NY traut sich mal richtig dunkles Fernsehen zu machen.
Und trotzdem skurrile, kuriose Fälle zu behandeln.
Ja. Aber die amerikanische Gesellschaft hat ein anderes Verhältnis zum Verbrechen und zur Gewalt. Wenn man in Amerika eine Zeitung aufschlägt, dann haben die natürlich auch, Entschuldigung, die interessanteren Vorlagen. Dort gibt es eine Verbrechenskultur, die wir Gott sei Dank nicht haben, aber die für Filme unglaublich viel hergibt.
Was gucken Sie noch?
Dr. House, Die Sopranos, Six Feet Under, Boston Legal…
Natürlich.
Auch Sitcoms? Was ist mit Frasier?
Frasier, herrlich! Will & Grace…
Und Will & Grace wurde Ihnen nicht nach der zweiten Staffel zu albern?
Doch, aber die ersten zwei Jahre waren großartig. Und Criminal Minds, kennen Sie das?
Ich halte das für eine der schwächeren, aber selbst das ist noch eine gut gemachte Serie.
Da habe ich gerade eine ganz tolle Folge gesehen, stilistisch unheimlich gut gemacht. Von The Unit habe ich zwei Folgen gesehen, das schreibt David Mamet, was mich sehr erstaunt hat, aber das hat mich erst mal nicht so umgehauen. Aber trotzdem: Im Großen und Ganzen ist es fantastisch, was die da drüben treiben. Und englisches Fernsehen gucke ich auch mit großer Begeisterung. Und in Deutschland möchte man immer mal so einen Wake-up-call starten.
Aber dazu gehört auch Mut von Sender- und Produzentenseite. Es ist nicht so, dass hier keine tollen Konzepte durch die Gegend fliegen. Die bekomme ich ja dauernd vor die Nase gehalten. Aber die werden dann komischerweise seltenst gemacht.
Warum nicht?
Das kann nur die Angst vor der schlechten Quote sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das hat wohl auch mit der deutschen Mentalität zu tun. Wir hatten jetzt drei oder vier Jahre lang eine Medienkrise. Die hatten die Amerikaner auch, nur ein bisschen früher. Aber in der Krise sagen die Amerikaner Okay, jetzt läuft gar nichts, experimentieren wir mal. Und dann lassen die Sachen steigen wie Six Feet Under und Sopranos und ich weiß nicht was. An dem Punkt sind die Amerikaner Unternehmer. Dann schmeißen sie auch mal zehn Piloten an die Wand, und davon bleiben zwei haften. Und die machen sie dann. Und das werden dann Welthits.
Wenn bei uns die Krise ausbricht, dann werden die Leute so panisch, dass sie überhaupt nichts mehr wagen. Sie machen nur noch das, was schon mal gemacht wurde. Wenn es irgendwie ein bisschen gelaufen ist, vielleicht können wir noch einen kleinen Hinterherkleckererfolg haben. Bei uns gibt es diese Ängstlichkeit, dass man nur noch schaut: Was macht denn der Andere, aha, damit haben die gerade fünfzehn Prozent, ah, dann machen wir das auch, nur ein bisschen halbherziger. Das hat meines Erachtens auch viel mit der deutschen Vorsicht zu tun, der deutschen Ängstlichkeit. Wir sind kein Volk von radikalen Unternehmern.
Verfolgen Sie denn auch das deutsche Fernsehen?
Oh ja. Gerade die guten Sachen schaue ich mir alle an. Aber ich schaue mir auch diese sogenannten Eventmovies an, die mich allerdings nicht vom Hocker hauen, weil es immer „Titanic“ ist vor unterschiedlichem historischem Background. Da wird eine geschätzte Kollegin zwischen zwei Herren unterschiedlicher Gesellschaftsschicht hin- und hergerissen, und das läuft dann mal vor Bombennächten in Dresden und mal vor der Sturmflut, das ist immer die gleiche Schote.
Ich schaue mir aber auch Polizeiruf 110 vornehmlich von Dominik Graf an, und es gibt tolle Bella Block-Folgen, es gibt fantastische Sachen im deutschen Fernsehen. Und ganz ehrlich: Heinrich Breloer hat für mich mal einen Meilenstein gesetzt, der hieß „Das Todesspiel“. Das war ein genialer Film. Ich möchte um Gottes Willen nicht alles niederbürsten, was hier über den Bildschirm flimmert, aber die Latte der Amerikaner liegt eben verdammt hoch.
Aber warum gelingt es bisher so selten, die Qualität, die man in vielen deutschen Fernsehfilmen vorfindet, auch auf deutsche Serien zu übertragen?
Da haben wir einfach ein Autorenproblem. Denn die guten Autoren haben keine Lust auf Serien. Wir haben bei Post Mortem wirklich alle meine Schreibidole angefragt, und die haben ohne Ausnahme abgesagt. Die haben Kinoangebote, Angebote für 90-minüter und für Mehrteiler. Die können wir für die Serie nicht gewinnen, da muss in den Schulen was passieren.
Aber mit den Büchern für Post Mortem waren Sie dann letztendlich doch zufrieden?
Weil wir an diesen Büchern immer wieder herumgefeilt haben. Da will ich niemandem einen Vorwurf machen. Es ist schwer, ein 45-Minuten-Format mit zwei Plots zu bestücken, die jeweils eigentlich ein Tatort-Plot sein könnten. Die Produktionsfirma Sony hat mir das angeboten als Autor, und ich habe es abgelehnt, weil mir das zu schwer war. Ich bräuchte für eine Folge ein halbes Jahr. Und die Zeit habe ich nicht. Ich habe jede Menge Verständnis für die Autoren, die das schreiben, aber da muss in Deutschland auch im Ausbildungsbereich was passieren, damit wir einen anderen Pool kriegen von Leuten, die dieses Format einfach beherrschen.
Aber die neun Bücher, die wir jetzt haben, kann ich wirklich vertreten. Weil auch die Kollegen, allen voran Charly Hübner, sich auf fantastische Weise eingebracht haben.
Wie reagieren die eigentlichen Autoren, wenn Sie als Schauspieler an den Dialogen herumdoktern?
Ganz kollaborativ. Unser Headwriter Lorenz Lau-Uhle ist total in Ordnung. Aber bei einer Serie ist das ein organisatorisches Problem. Der Pilot wird ein Jahr entwickelt und basiert dadurch auf einem großartigen Buch. Dann kommt der Produktionsauftrag, Der kommt aber dann, sagen wir mal, vier Monate vor Drehbeginn. Es entsteht ein Zeitdruck, bei dem die Autoren gar nicht hinterherkommen können, weil sie für die restlichen acht Folgen der ersten Staffel sechzehn Geschichten erarbeiten müssen. Das muss man erst hinkriegen. Letztendlich beginnt man dann mit den Drehabreiten, bevor die Drehbücher fertig sind. Aber wir haben es hingekriegt, das werden Sie sehen.
Da läuft wirklich ganz viel falsch in Deutschland. CSI-Produzent Jerry Bruckheimer hat dreißig Autoren zur Verfügung! Ich habe mal ein Jahr lang Highlander: The Raven gemacht, und da war direkt über dem Produktionsbüro ein Großraumbüro, da saßen zwölf Autoren und haben Highlander geschrieben. Und einmal am Tag ging der Produzent Bill Panzer durch und hat denen über die Schulter geguckt. Das läuft dort eben anders. Der Schreibbetrieb drüben ist ein Servicebetrieb. Wenn das Buch nicht funktioniert, ab in die Tonne. Wir haben aber nicht das Geld, um zu sagen, das Buch funktioniert nicht, lieber Autor X, das schmeißen wir weg, geh noch mal neu ran. Denn dann müssten wir noch mal neu bezahlen, und die Kohle wird in Deutschland nicht ausgegeben. Die Amerikaner investieren in das Buch ein x-faches von dem, was wir investieren.
Ein anderes typisch deutsches Phänomen ist, dass Schauspieler nach verhältnismäßig kurzer Zeit aus einer Serie aussteigen mit dem Argument, sich nicht auf eine Rolle festlegen zu wollen. Und gerade ein Krimi ist ja ein Format, bei dem eher die Fälle als die Charaktere im Vordergrund stehen. Ist das trotzdem ein Projekt, an das Sie sich längerfristig binden könnten?
Es ist ja meine erste deutsche Serie. Und ich habe gesagt: Ich mache das gerne, wenn ich Thomas Jauch mitbringen darf. Und diese Bedingung wurde mir von der Produktionsfirma Sony großartigerweise erfüllt. Das heißt, wenn wir eine gute Quote haben und gute Bücher bekommen, dann mache ich das weiter.
Sie könnten sich vorstellen, den Gerichtsmediziner Daniel Koch 100 Folgen zu spielen?
100 Folgen würde ich jetzt mal nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall gesagt, dass ich eine weitere Staffel mache, wenn die Quote stimmt. Ich drehe als Nächstes einen NDR-Film, da spiele ich einen Konditormeister, und dann mache ich wahrscheinlich einen historischen Film fürs ZDF. Insofern langweile ich mich noch nicht als Schauspieler. Wenn ich dann zwischendurch noch mal neun Folgen Post Mortem drehe, mache ich danach wieder so radikal andere Sachen, dass ich nicht die Angst habe, mich den Rest meines Lebens in der Rechtsmedizin über Leichen zu beugen.
Ist doch nur Rechtschreibung
RTL teilt folgende „Programmänderung“ mit: Der Titel der am 3. September startenden Clipshow lautet nicht mehr Ist doch nur Spaß …!?, sondern: Ist doch nur Spass.
Darunter steht: „Bitte beachten Sie die geänderte Schreibeweise der neuen Comedy-Sendung ‚Ist doch nur Spass'“.
Um mit dem Titel einer anderen neuen RTL-Show zu sprechen, die ebenfalls im September startet: Setzen, Sechs!
Ist doch nur Spass
Seit 2007 (RTL). Halbstündige Comedyshow mit der versteckten Kamera und ohne Worte. Ahnungslose Menschen tappen in die Lustigkeitsfalle absurder Situationen, und niemand muss sich umständlich herauslavieren, es kommt nur auf das dumme Gesicht an, das die Betroffenen machen. Weder hört man die Protagonisten sprechen, noch gibt ein Off-Sprecher seinen Senf dazu, die kurzen Szenen sind lediglich mit Musik unterlegt.
Die Filmchen stammen aus den internationalen Varianten der Show „Just For Laughs Gags“, die ihren Ursprung in Kanada hatte. Ben macht zu Beginn der Sendung eine kurze Ansage.
Läuft werktags um 17.00 Uhr.
Ist ja auch egal
Die ist eines der Phänomene der deutschen Fernsehlandschaft. Die könnten die Nachrichten in Latein verlesen mit zwei brennenden Kerzen, und die Sendung hätte immer noch gute Ratings.
Diesen Satz sagte vor mehr als zwanzig Jahren der damalige RTL-Chef Helmut Thoma über die Tagesschau mit einer Mischung aus Neid und Anerkennung. Inzwischen verfügt RTL selbst über eine Sendung, die derart zur Instanz geworden ist, dass sie offenbar geguckt wird, egal was passiert. Sie heißt Ich bin ein Star – holt mich hier raus und ist in diesem so erfolgreich wie noch nie. Normalerweise leiden Shows dieses Genres nach zehn Jahren an deutlichen Abnutzungserscheinungen und haben den Sensationsstatus ihrer frühen Tage längst verloren, falls sie überhaupt noch auf Sendung sind. Das Dschungelcamp dagegen liegt vier Tage vor Schluss im Schnitt 390.000 Zuschauer über der bisher meistgesehenen Staffel aus dem Jahr 2011 mit Sarah „Dingens“ Knappik, Jay Khan und Dschungelkönig Peer Kusmagk. Zum ersten Mal hatte dieses Jahr (bisher) keine einzige Ausgabe weniger als sieben Millionen Zuschauer.
Liegt es daran, dass Ich bin ein Star… der Tagesschau immer ähnlicher wird? In beiden Sendungen passiert eigentlich gar nicht viel, und zurzeit geht es u.a. um eine Frau, die nichts tut, aber immer wiedergewählt wird.
Wohl kaum. Tatsächlich scheint sich aber eine gewisse Scheißegal-Haltung unter den Machern auszubreiten, denn die Quoten sind ja eh immer gut.
- „Wollen wir diesmal vielleicht die Hälfte der Teilnehmer gleich zu Beginn aus einem Flugzeug springen lassen?“ – „Wie wirkt sich das auf den Spielablauf aus, und hat es Konsequenzen für diejenigen, die sich weigern?“ – „Öhm – ist doch egal!“
- „Kommt, wir zeigen heute in den ersten zwanzig Minuten diese alten Szenen von vorgestern, die liefen noch nicht.“ – „Aber da ist Mola noch dabei, und der ist doch gestern rausgeflogen!“ – „Umpf – ist doch egal!“
- „Komm wir sagen den Kandidatinnen heute mal, sie seien es alle nicht, werfen dann aber trotzdem eine von ihnen raus, weil wir die erste Aussage nachträglich auf was völlig anderes beziehen!“ – „Meinst du, das vermittelt sich auf die Schnelle? Vielleicht verwirrt das die Kandidaten und die Zuschauer zu sehr!“ – „Ach, ist doch egal!“

Foto: RTL
Der Nominierungsprozess um die Frage, wer zur Dschungelprüfung antritt, ist eher einige witzige Veranstaltung, da benötigt man keine Spannung und kann ruhig schon in der Vorschau zeigen, wen es treffen wird. Die Prüfungen an sich könnten aber durchaus enorme Spannung bieten, und tun es an manchen Tagen auch. Am Montagabend war das nicht der Fall, denn schon im Ausblick vor der Werbepause konnte man sehen, wie Prüfling Jochen aus dem Kakerlakensarg herauskriecht und alle sieben Sterne ordnungsgemäß an der Wand angeschraubt sind. Ist ja auch egal.
Die Schatzsuche, als Spielelement eigentlich ein schöner Bestandteil der Show, bedeutet nicht nur für die Kandidaten manchmal Mühe, sondern auch für das Produktionsteam bei der Vorbereitung. Also kann man’s ja auch bleiben lassen. An den ersten sieben Tagen gab es dieses Jahr nur eine einzige Schatzsuche, stattdessen war einfach etwas ausführlicher zu sehen, wie die verhaltensauffällige Larissa und die anderen Teilnehmer am Lagerfeuer ihre Diskrepanzen austrugen. Egal.
Dazu kommt, dass die Sympathie der Moderatoren leidet, wenn die bissigen Gags nach Skript bei Daniel Hartwich nur wenige Sekunden später im Extra-Interview in ungeskriptete Arroganz gegenüber der Reporterin umschlagen, die nicht als Kandidatin im Dschungel ist, sondern als RTL-Mitarbeiterin, er sie aber trotzdem ungebremst auflaufen lässt. Klar, manche ihrer Fragen wirken dämlich, aber was soll sie denn machen, wenn sie keine Gagschreiber und keinen wirklichen Inhalt hat, aber die Aufgabe, der Dschungelshow möglichst sendezeitfüllend zu huldigen.
Nachdem gestern Abend kurz vor dem Rauswurf erst einmal alle Kandidatinnen verwirrt wurden mit der klaren Ansage, sie seien es NICHT (wesentlich unklarerer Nachsatz: Die von Mörtel-Lugner zum Opernball eingeladen werden), griff die Verwirrung auch auf die Moderatoren über. Am Ende wiesen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich wie gewohnt auf das Anschlussprogramm hin: Den Bachelor. Vielmehr: Den „Glatzen-Bachelor“, den „Neurosenkavalier“. Der kam aber gar nicht. Es kam wie an jedem Werktag um Mitternacht das Nachtjournal (das in dieser Woche übrigens von Graf Zahl moderiert wird, aber das nur am Rande). Aber vielleicht war das ja auch irgendein Gag, den ich nicht verstanden habe. Umpf. Ist doch egal. Dem Nachtjournal hat das nicht geschadet. Und dem Dschungel scheint ja derzeit gar nichts schaden zu können.
Ich bin ein Star – holt mich hier raus ist immer noch eine der besten und unterhaltsamsten Sendungen im Fernsehen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass sie ab der nächsten Staffel in Latein gesendet wird.