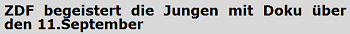Roseanne
1991–1997 (ProSieben). 222‑tlg. US-Sitcom von Matt Williams und Roseanne Barr bzw. Roseanne Arnold, je nachdem, mit wem sie gerade verheiratet war („Roseanne“; 1988–1997).
Roseanne Conner (Roseanne) ist laut und schrill und hat einen bitterbösen Galgenhumor. Hinter der harten Schale steckt ein weicher Kern, aber die harte Schale ist sehr, sehr dick. Ihr Mann Dan (John Goodman) nimmt es an Gewicht und Cholerik mit ihr auf, ist seiner Frau aber im Zweifelsfall unterlegen. Sie leben in einem Haus in Lanford, Illinois, mit ihren zwei Töchtern, der gutaussehenden Becky (Lecy Goranson; in Staffel 6 und 7: Sara Chalke) und der rebellischen Darlene (Sara Gilbert), und dem unter den ganzen starken Frauen im Haus leidenden Sohn „DJ“ David Jacob (Michael Fishman). Irgendwie lieben Roseanne und Dan ihre Kinder, doch gehen sie ihnen oft auf die Nerven, und so blaffen sie sie schon mal an, sie sollten doch in den Berufsverkehr spielen gehen.
Roseanne hat wechselnde Jobs, u. a. im Fast-Food-Restaurant „Lanford Lunch Box“, das sie gemeinsam mit ihrer neurotischen Schwester Jackie (Laurie Metcalf) führt. Dan hat zunächst ebenfalls verschiedene Jobs und wird später arbeitslos. Geld hat die Familie fast nie, Schulden umso mehr. Becky verliebt sich in den schlichten Mark Healey (Glenn Quinn), Darlene hat eine langjährige, komplizierte Beziehung mit dessen Bruder David (Johnny Galecki). Bev Harris (Estelle Parsons) ist die unerträgliche Mutter von Roseanne und Jackie, Arnie Merchant (Tom Arnold) der beste Freund von Dan, Leon Carp (Martin Mull) der schwule Chef von Roseanne, Nancy Bartlett (Sandra Bernhard) ihre bisexuelle Freundin. Am Ende wird Roseanne noch einmal schwanger, und die finanziellen Probleme der Familie lösen sich durch einen Lottogewinn.
Mit dem Start von Roseanne waren die sonst typischen Vorzeigemütter der amerikanischen Familienserien erst mal am Ende. Roseanne warf in ihrer eigenen Serie alles über den Haufen. Sie selbst hatte die Serie und die Figur erfunden, war als Produzentin verantwortlich und nahm auch auf die Drehbücher Einfluss. Anders als bei Eine schrecklich nette Familie war die Zerstörung des Ideals vom glücklichen, gesunden Familienleben bei Roseanne nicht nur eine Groteske und ein Anlass für Pointen, sondern der sehr ernste und oft ungemütlich ehrliche Versuch, die wahren Abgründe und Überforderungen hinter den Fassaden zu zeigen.
Es ging um Themen wie Homosexualität, Gewalt in der Ehe, Sex im Teenageralter, Drogen, Untreue, den Kampf der Unterschicht um ein bisschen Respekt und Selbstbestimmung, aber auch um die alltäglichen Auseinandersetzungen zwischen pubertierenden Kindern und Eltern, die viel zu wenig Zeit für sie haben. Anders als in anderen Serien setzten sich die Conners nicht irgendwann zusammen und diskutierten all das mal vernünftig aus, sondern brüllten sich an und zofften sich in zuvor im amerikanischen Fernsehen ungehörter Weise. So zynisch und brutal das häufig war, so bewegend wirkten zwischendurch Szenen, in denen die Verletzlichkeit der Charaktere und ihre Liebe zueinander erkennbar wurde.
Für große Aufregung in den USA sorgte schon im Vorfeld der Kuss zwischen Roseanne und Gaststar Mariel Hemingway in einer Lesbenbar – von dem sich dann herausstellte, dass man ihn gar nicht sah, weil er entsprechend raffiniert gefilmt worden war. Hinter den Kulissen herrschte ohnehin immer Aufregung. Die Show galt als schlimmster Arbeitsplatz im amerikanischen Fernsehgeschäft. Roseanne zerstritt sich gleich mit dem Chefautor Matt Williams und versuchte vergeblich zu verhindern, dass er im Vorspann allein als „creator“ genannt wird. Ihren eigenen Namen änderte sie zweimal. Zunächst tauchte sie mit ihrem Mädchennamen Roseanne Barr auf. Nach der Hochzeit mit ihrem Roseanne-Kollegen Tom Arnold nannte sie sich Roseanne Arnold. Nach der Scheidung, die öffentlich in den Boulevardzeitungen ausgeschlachtet wurde, ließ sie jeden Nachnamen weg.
Dass die Connors in der letzten Staffel von allen Geldsorgen befreit sind, entzog der Serie vollständig ihre Grundlage. Der Plot wird als groteske Fehlentscheidung oder aber als von Roseanne wohlkalkulierter Selbstmord der Figur angesehen. In einer der letzten Folgen trifft Roseanne Edina und Patsy aus Absolutely Fabulous – ein seltener Crossover zwischen einer amerikanischen und einer britischen Serie. (Roseanne hatte die Rechte an einer US-Adaption von Absolutely Fabulous gekauft, zu der es jedoch nie kam.)
Bemerkenswert war der Umgang mit der Umbesetzung der Rolle von Becky. Als die ursprüngliche Darstellerin Lecy Goranson nach zwei Staffeln wieder auftauchte, wurde sie von allen anderen Figuren verwundert gefragt, wo sie so lange gesteckt habe, wodurch die Grenze zwischen Realität und Fiktion verschwamm, da die Serienfigur ja keineswegs verschwunden war. Im Abspann dieser Folge waren beide Becky-Darstellerinnen zu sehen.
Die Serie wurde ein enormer Erfolg und war eine der wenigen US-Sitcoms, die auch in Deutschland gute Einschaltquoten erzielten. Sie lief bei uns täglich im Vorabendprogramm.