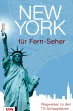1964-1987 (ARD). „Das große internationale Quiz“ mit Hans-Joachim Kulenkampff.
Acht Kandidaten (je vier Männer und Frauen) aus acht Ländern spielen in wechselnder Zusammenstellung im Ausscheidungsverfahren gegeneinander. In der ersten Runde treten jeweils zwei Kandidaten gleichen Geschlechts gegeneinander an und müssen Fragen zur Allgemeinbildung beantworten. Beide bekommen die gleichen Fragen gestellt, weshalb einer immer in eine schalldichte Kabine muss. Die vier Sieger ziehen in die Zwischenrunde ein. Bei einem Gleichstand gibt es anfangs zunächst Stichfragen, dann wird gegebenenfalls gewürfelt, in den 80er‑Jahren wird sofort gewürfelt. Für die Zwischenrunde werden zwei gemischt-geschlechtliche Zweierteams ausgelost, die nun gemeinsam weitere Wissensfragen beantworten und Geschicklichkeitsübungen bewältigen müssen. In einem Spiel teilen sie sich auf. Einer der beiden bekommt drei Fragen gestellt. Weiß er die Antwort nicht, kann sein Mitspieler durch die Geschicklichkeitsaufgabe den Punkt doch noch holen. In einem anderen, reinen Fragespiel dürfen sie sich beraten und müssen sich dann auf eine gemeinsame Antwort festlegen. Die beiden Mitglieder der Siegermannschaft spielen nun im Finale gegeneinander. Einer nimmt auf einem Sessel Platz, der auf einem Podest steht, und beantwortet drei Fragen, während der andere wieder in der schalldichten Kabine sitzt, weil ihm anschließend dieselben Fragen gestellt werden. Bei einem Gleichstand entscheiden bis zu zwei Stichfragen, danach wird notfalls der Gewinn geteilt. Zwischen den Spielrunden gibt es drei Showauftritte.
Der Titel der Show wurde „EWG“ abgekürzt, was nicht zufällig auch die Abkürzung für die gerade zusammenwachsende „Europäische Wirtschaftsgemeinschaft“ war. Das Quiz war eine der erfolgreichsten, beliebtesten und langlebigsten Sendungen, die es im deutschen Fernsehen gab. Sie lief als große Abendshow ca. sechsmal im Jahr samstags live um 20.15 Uhr, war eigentlich 105 Minuten lang, Kulenkampff („Kuli“) überzog aber ständig. Bis auf die Geschicklichkeitsspiele in der Zwischenrunde bestanden alle Runden aus Fragen zur Allgemeinbildung. Die Fragen wurden durch aufwendige Bauten, Kulissen, musikalische Darbietungen, Live-Spielszenen mit prominenten Schauspielern oder Einspielfilme illustriert, waren letztendlich aber doch immer nur Wissensfragen, die auch ohne diese Gimmicks hätten gestellt werden können. Das hätte die Show auf etwa eine Dreiviertelstunde gekürzt, sie aber eintöniger gemacht: Durch Bauten und Kostüme unterschied sie sich vom klassischen Abfragequiz. In den Einspielfilmen spielte Kulenkampff selbst mit und parodierte in pompösen Kostümen Figuren der Historie oder des klassischen Theaters. Es folgten Fragen aus den Bereichen Geschichte oder Theater und Literatur. Wer ausschied, erhielt als Trostpreis Goldmünzen, deren Zahl höher wurde, je länger der Kandidat im Spiel war. Der Hauptgewinn für den Sieger lag zu Beginn bei 2000 DM, Ende der 60er‑Jahre schon bei 4000 und zum Schluss bei 8000 DM.
Obwohl die Kandidaten nicht – wie z. B. in Peter Frankenfelds Sendungen – spontan aus dem Publikum ausgewählt wurden, sondern vorher feststanden, kannte Kuli sie nicht, bevor sie auf die Bühne kamen. Oft wirkte es, als habe auch sonst niemand, der an der Show beteiligt war, eine Ahnung gehabt. So fragte Kulenkampff fast 24 Jahre lang bei den Namen seiner ausländischen Mitspieler immer wieder nach, und 1969 gewann eine Medizinerin, nachdem ihr, aber auch allen anderen Kandidaten, im Laufe des Abends etliche Fragen aus dem Bereich Medizin gestellt worden waren. „Menschenskinder, das konnte ja keiner ahnen!“. Ach, nicht? Die Kandidaten kamen immer aus acht verschiedenen Ländern, deren Zusammenstellung variierte. Wer zu Kuli kam, sprach zwar in der Regel hervorragend deutsch, hatte gegenüber den Muttersprachlern aber einen leichten Nachteil. Bei den meisten Fragen gab es eine zeitliche Begrenzung von zehn Sekunden. Wer dann noch im Geiste die Frage übersetzen musste, hatte nicht mehr viel Zeit zum Nachdenken. So gewannen selten die Teilnehmer aus Großbritannien, Italien, Spanien, Jugoslawien, Ungarn, der Tschechoslowakei, Finnland, Schweden, Holland, Dänemark oder den USA, dafür meistens die Deutschen, Österreicher oder Schweizer.
EWG war eine Eurovisionssendung und wurde aus wechselnden Hallen übertragen.
Was EWG einzigartig machte, waren vor allem Kulis endlose Monologe. Eingangs machte er einige Witze zum aktuellen Tagesgeschehen, während der Show wich er vom eigentlichen Thema ab und nahm einzelne Bestandteile einer Antwort oder eines Gesprächs zum Anlass, darüber zu referieren. Fiel ihm eine Anekdote zum Beruf oder zur Herkunft eines Kandidaten ein, erzählte er sie. Fiel ihm noch eine ein, erzählte er sie auch. Er überschüttete seine Kandidatinnen (und vor allem seine Assistentinnen) mit Komplimenten, war immer der große Charmeur mit einem Hang zum Herrenwitz. Zwischendurch begrüßte er die gerade dazugekommenen Zuschauer der soeben im anderen Programm zu Ende gegangenen Fußball-Übertragung, telefonierte mit den „hohen Herren“, die die Einhaltung der Spielregeln überwachten und bei Unklarheiten anriefen, und ging auf Beschwerden ein, die während der Live-Sendung telefonisch beim Sender eingegangen waren. Nach einem Verriss in einer Tageszeitung griff er den Hauptkritikpunkt auf und hieß die Zuschauer beim nächsten Mal zu einem „langweiligen Abend“ willkommen, denn nach einer stressigen Woche habe jeder das Recht auf ein wenig Langeweile.
Je länger die Sendung lief, desto mehr rückte Kulenkampff selbst in den Mittelpunkt. Oft überzog er seine Sendezeit um eine halbe Stunde oder länger – und zelebrierte es.
Am Ende jeder Show trat Martin Jente (der Produzent der Sendung) als Butler „Herr Martin“ auf, der Kuli den Mantel brachte und einige spitze Bemerkungen zur Show und ihrem Quizmaster anbrachte („Immer wenn ich Ihre Sendung sehe, denke ich: Seine Stärke muss doch auf einem anderen Gebiet liegen“). Im Januar 1969 überreichte Jente Kuli noch vor dem Mantel den erstmals verliehenen Fernseh-Bambi (was Kulenkampff eine schöne Gelegenheit für eine kleine Rede gab). Kuli verschliss im Lauf der Jahrzehnte einige junge Assistentinnen, die bekanntesten waren in den 60er‑Jahren Uschi Siebert und in den 80ern Gabi Kimpfel. Das Orchester des Hessischen Rundfunks lieferte die musikalische Untermalung, anfangs unter der Leitung von Willy Berking, der mit Kulenkampff schon in Die glücklichen Vier aufgetreten war, später geleitet von Heinz Schönberger, der ebenfalls schon eine andere Kuli-Show mitgemacht hatte: Acht nach acht.
Insgesamt dreimal nahm Kuli seinen Hut als Moderator von EWG, zweimal ließ er sich überreden, die Sendung neu aufzulegen. Nach seinem Abschied im August 1966 dauerte es nur eineinhalb Jahre, bis er zurückkehrte. Nach weiteren eineinhalb Jahren gab er die Sendung im August 1969 zum zweiten Mal auf. Diesmal dauerte es fast zehn Jahre, bis es ein erneutes Comeback gab. In den ersten vier Jahren waren zwei neue Quizsendungen mit Kulenkampff gefloppt. Kulenkampff hatte damals geschworen, nie mehr ein Quiz zu moderieren. Sechs Jahre später, im September 1979, kehrte er mit EWG auf den Bildschirm zurück. Sein Abschied im Jahr 1987 nach 82 Ausgaben war endgültig. Man erkannte es daran, dass er sich von Paul Anka eine auf ihn umgemünzte Version von „My Way“ singen ließ (Anka war der Autor des Songs, er hatte ihn für Frank Sinatra geschrieben). Außerdem hielt er zum Abschluss eine Best-of-EWG-Schallplatte hoch („Ich möchte das auch einmal tun!“), von deren Erlös ein paar Mark an die Stiftung zur Rettung Schiffbrüchiger gingen („Ich segel doch so gern“). Auf diese Weise habe er schon einen Teil abbezahlt, falls er mal aus dem Meer gefischt werden müsse.
Der Versuch einer Neuauflage mit dem neuen Moderator Jörg Kachelmann im Jahr 1998 misslang grandios.